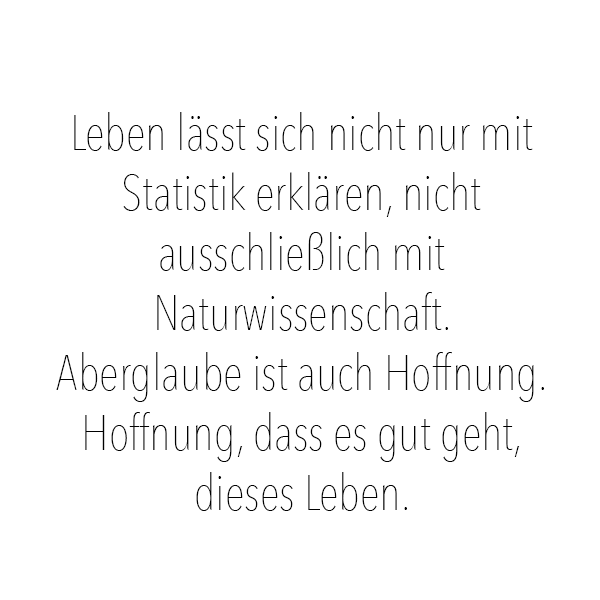Unsere Autorin war schon immer abergläubisch. Sie glaubt an gute Zahlen und klopft auf Holz. Sie weiß, dass das Quatsch ist, und kann nicht davon lassen. Sollte sie?
ZEIT ONLINE, Ressort X, Aberglauben Sie das wirklich?, 17. März 2021
Als mein Wecker am Silvestermorgen um 11.11 Uhr klingelt, blicke ich auf die vier gleichen Zahlen und wünsche mir etwas. Wie jeden Tag setze ich zuerst meinen rechten Fuß auf den kalten Laminatboden, dann den linken und stehe auf.
Als wir am Silvesterabend zu viert kochen, meinem Freund das Salz aus der Hand rutscht und sich auf dem Küchenfußboden verteilt, sage ich: „Oh, oh.“ Und als ich verstehe, dass keiner den Ernst der Lage versteht, ergänze ich: „Salz verschütten bringt Pech.“ Alle lachen. Also hebe ich ein paar der Salzkörner auf, stelle mich ans offene Fenster und werfe sie über die linke Schulter hinter mich. Irgendwer muss es ja machen.
Als ich kurz vor Mitternacht auf die Straße eile, Wunderkerzen, Goldregen und zwei Sektschalen in der Hand, und meine Nachbarin mich fragt, ob ich rote Unterwäsche trage, so wie sie, denke ich: Endlich arbeitet mal jemand mit.
Als ich mir den Daumen an einer Wunderkerze verbrenne, mein Freund sich Champagner über das T-Shirt schüttet und einem unserer Freunde sein Handy auf den Boden fällt und das Display bricht, denke ich: Na, wenn das mal keine schlechten Zeichen sind.
In den kommenden zwei Tagen verbrenne ich mir noch zwei Mal die Hand am Ofen. Man könnte glauben, dass ich einfach nur unvorsichtig mit heißen Gegenständen umgehe, ich hingegen denke: Ich hab’s geahnt.
Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der ich besonders abergläubisch werde. Alle glücksbringenden, pechvermeidenden und wunscherfüllenden Rituale müssen an diesem Tag korrekt ausgeführt werden, schließlich geht es um nichts Geringeres als die Weichenstellung für die kommenden 365 Tage. Über die Jahre hat sich ein festes Programm etabliert: die Uhrzeit, der rechte Fuß, eine Wunderkerze, die ich jedes Jahr angucke, als könne sie das wirklich: Wunder vollbringen.
Als ich abends die rote Unterwäsche aus der Schublade hole, denke ich an das letzte Silvester. Eine kleine Party, immerhin zehn Leute und eigentlich standen die Zeichen auf Glück. Dann fällt mir ein, dass ich zum ersten Mal seit Jahren beschlossen hatte, einen BH mit Pailletten anzuziehen, die silbern funkelten, nicht rot. Schon klar, dass ich damit vermutlich keine weltweite Pandemie ausgelöst habe, aber ein kleiner Teil in mir flüstert: Wer weiß.
Aberglauben kann man nicht ernst nehmen, das zeigt schon der Begriff selbst: Er kommt vom Missglauben, dem falschen Glauben. Der Disclaimer steckt im Wort: Ich weiß ja, dass es falsch ist. Was in Deutschland Glaube und was Aberglaube ist, das hat vor vielen Jahrhunderten die christliche Kirche festgelegt. Heidnische Rituale wurden entweder übernommen oder diskreditiert, und über die Jahrhunderte blieb der Begriff für all jenes, das man glaubt – wider besseres Wissen.
Ich bin nicht religiös, aber ich glaube an Dinge. Ich nenne mich selbst abergläubisch, weil die Menschen dann am schnellsten verstehen, was ich meine, aber eigentlich halte ich diesen Begriff für falsch. So wie die Einteilung in richtigen und falschen Glauben. Trotzdem versuche ich die Irrationalität zu verbergen. Ich finde, sie passt nicht zu mir. Ich bin Journalistin und Fakten sind der Kern meines Berufs.
Früher, wenn in der Kneipe das Gespräch auf komische Angewohnheiten kam, erzählte ich, dass ich am liebsten zu Uhrzeiten aufstehe, deren Quersumme sieben ergibt. Ich konnte meinen Freunden dann beim Rechnen zugucken, wie sich die Augen verengten und sie angestrengt überlegten, welche Uhrzeiten das sein könnten. „Viertel vor acht“, sagte ich dann. „Sieben plus vier plus fünf ist 16. Und eins plus sechs ist sieben.“ Dass das nicht nur eine schrullige Angewohnheit ist, sondern dass ich tatsächlich glaube, es bringe Glück, verriet ich nur manchmal.
Sieben ist die Quersumme meines Geburtsdatums. Ich mache das, seit ich ein kleines Mädchen war, bis heute habe ich das nie infrage gestellt. Noch besser als die Quersumme sieben sind übrigens die gleichen Ziffern auf der Uhr: 11.11 Uhr, wie an Silvester. Irgendjemand hat mir erzählt, dass man sich etwas wünschen dürfe, wenn man dann auf die Uhr blickt. Ich weiß, dass es dafür keinen wissenschaftlichen Beleg gibt. Das war mir immer egal, mir reichten das Glück und die erfüllten Wünsche. Realistische Wünsche, keine Wunder, aber immerhin. Klopf, klopf, klopf.
Seit der Pandemie hat sich der Wert der Vernunft verändert. Ultima Ratio ist es nun, sich von der Ratio leiten zu lassen, auf Evidenz und Inzidenz zu vertrauen und dort wo Koinzidenz auftritt, Zufall zu sehen, nicht aber Zusammenhang.
Wir erklären uns die Welt mit Formeln und Zahlen, Diagrammen und Statistiken. Auch ich mache das. Erkrankt jemand, reden wir über Wahrscheinlichkeiten und Verlaufsformen. Stirbt jemand, fragen wir nach Vorerkrankungen oder dem Alter. Diese Nüchternheit gibt uns das Gefühl, die Kontrolle zu haben, wenigstens ein bisschen. Etwas zu begreifen bedeutet aber nicht immer, es zu verstehen. Ratio allein ist trostlos.
Vor Corona war mein Aberglaube lustig, heute habe ich das Gefühl, dass mich manchmal Menschen angucken und sich fragen: Wenn sie das schon glaubt, was glaubt sie dann noch? Ich spüre, dass man sich zu entscheiden hat: Kopf- oder Bauchmensch? Beides zu sein scheint nicht mehr zu funktionieren. Ein Kollege nennt meinen Aberglauben Zwangsstörung und scheint sich in dieser rationalen Bezeichnung sehr wohl zu fühlen. Eine Freundin fragt hin und wieder, ob das wirklich mein Ernst sei und lacht und lacht und lacht.
Mir selbst war mein Aberglaube immer egal. Er gehört zu mir, so wie mein Lieblingsessen, die Tonlage meiner Stimme oder dass ich ständig mit den Fingern knacke. Er hat keine bewusste Rolle in meinem Leben gespielt. Plötzlich fühle ich mich darauf reduziert und seltsam anders.
Dabei ist als Kind jeder Mensch abergläubisch. Wir kommen auf die Welt und halten uns für den Mittelpunkt des Universums, Entwicklungspsychologen nennen das egozentristische Weltsicht. Für einen Säugling existiert nur, was er sehen kann. Hände vor das Gesicht, Hände weg, Kuckuck, Babys kann man damit stundenlang unterhalten.
Kindliche Logik funktioniert nach anderen Gesetzen als die von Erwachsenen. Weil Kinder sich noch nicht in andere Menschen hineinversetzen können und am hypothetischen Denken scheitern, übertragen sie sich selbst auf den Rest der Welt. Kinder glauben, sie können mit ihren Gedanken ihre Umgebung steuern, Lebloses wird für sie lebendig, es gibt Monster, Elfen und wenn der Himmel bei Sonnenuntergang tiefrot leuchtet, dann backen die Engel gerade Plätzchen. Daran habe ich früher auch geglaubt.
Als meine Mutter mit meinem Bruder schwanger war und wir umziehen mussten, saßen meine Mutter und ich abends oft in meinem Kinderzimmer und haben uns zusammen fest gewünscht, dass wir ein Haus finden, indem auch für das neue Baby Platz ist. Noch bevor mein Bruder auf die Welt kam, zogen wir um und ich hatte den Beweis: Dinge werden wahr, wenn ich sie mir nur fest genug wünsche. Dass meine Eltern zu Besichtigungen gingen und einiges für die Wunscherfüllung taten, war für mich als Zweijährige nicht weiter relevant.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Rituale Macht haben. So wie meine Mutter früher mit mir zusammensaß und wir uns Dinge wünschten, so stellt sie heute, wenn ich weite Reisen mache, ein Foto von ihr und mir auf das weiße Regal mit den Kerzen, der kleinen Ganesha-Statue und den Fotos des indischen Gelehrten, dem ich als Kind immer etwas von meinem Geburtstagskuchen abgeben sollte. Sie nennt das Reiseschutz-Altar. An Heiligabend haben wir dem Foto meiner Oma ein Glas Sekt hingestellt und meine Mutter hat mit ihrer Mutter im Himmel angestoßen.
Die egozentristische Phase und das magische Denken enden meist mit dem Schulalter. Mit dem Eintritt in die Pubertät ist es dann wirklich vorbei. Vernunft schlägt Fantasie, so sagt es zumindest der Entwicklungspsychologe Jean Piaget. Ich erinnere mich an eine abgewandelte Version von Himmel oder Hölle, mit der wir auf dem Schulhof unsere zukünftigen Ehemänner weissagten. Ich erinnere mich an eine komplexe Zuweisung von Zahlen und Buchstaben mit denen man herausfand, wie gut man selbst und der aktuelle Schwarm zusammenpassten. Ich erinnere mich an sehr viele Gespräche über Horoskope, an Glücksbringer für Klassenarbeiten und später dann für das Abitur.
So wie ich mir irgendwann mal überlegt habe, dass es Glück bringen könnte, wenn ich zu einer Uhrzeit aufstehe, die mit meinem Geburtsdatum korreliert, stecken auch hinter den meisten Aberglauben einigermaßen logische Überlegungen.
Unter einer Leiter hindurchzugehen bringt Unglück, heißt es heute. Das klingt unspezifisch bedrohlich, hat aber einen wahren Kern. Zwar wird der Glaube damit erklärt, dass man ein Dreieck durchschreitet und damit den heiligen Raum – Vater, Sohn, Heiliger Geist – verletzt, aber der Satz stammt aus einer Zeit, in der Baustellen noch nicht TÜV-geprüft waren. Leitern wackelten und Farbtöpfe, Pinsel oder Hammer fielen schneller auf den Boden, im schlechtesten Fall auf denjenigen, der gerade unter der Leiter hindurchging. Die Menschen mieden Leitern, weil sie sich tatsächlich verletzen konnten. Kausalität statt Korrelation.
Kometen, Meteoriten und andere Himmelsphänomene beunruhigten die Menschen sehr – nicht völlig zu Unrecht, denkt man an die Dinosaurier. 1492 schlug ein Meteorit im Elsass ein. Der Krater war zwar nur ein Meter tief, doch die Menschen fürchteten, dass dies der erste Bote einer Katastrophe sein könnte oder eben der erste von vielen Meteoriten. Sternschnuppen hingegen zogen an der Erde vorbei ohne Schaden anzurichten. Was für ein Glück.
Das Gehirn kann gar nicht anders, als die Umwelt nach Mustern abzusuchen und sie auch zu finden. Deswegen haben wir Religionen, die mit brennenden Dornbüschen und Wundern arbeiten, deswegen haben wir Aberglaube, der, das sollte nun klar sein, auch nichts anderes ist als eine witzige Variante von Religion.
Der Psychologe Burrhus Skinner wies schon 1948 nach, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere abergläubisch sein können. Er setzte Tauben in eine Kiste, in die alle 15 Sekunden etwas Futter fiel. Ein Vogel begann sich im Kreis zu drehen, ein anderer flatterte mit den Flügeln und der nächste steckte den Schnabel in regelmäßigen Abständen in eine bestimmte Ecke der Kiste. Sie wiederholten die Bewegungen, die sie zufällig genau dann gemacht hatten, als das Futter in die Kiste fiel.
Ähnliche Experimente gibt es mit Menschen. Eine Puppe, die alle zwei Minuten eine Murmel ausspuckt, eine Lampe, die willkürlich leuchtet – den Probanden im Labor gab man die Aufgabe, es zu erklären. Auf der Suche nach einem Muster entwickelten die Versuchspersonen die seltsamsten Verhaltensweisen, von denen sie selbst dann überzeugt blieben, wenn diese nicht jedes Mal zum Erfolg führten. Dies liegt laut Neurologinnen daran, dass das Gehirn Dinge besser speichert, wenn sie positiv, also erwartungsgemäß ausgehen. Wer etwas erwartet und das Erwartete tritt ein, der merkt sich das besser als die zehn, 20 oder 100 Male, in denen es nicht eintritt, selbst wenn alles nur Zufall ist.
Wer nach einer Erklärung sucht, der wird sie finden. Es ist nur nicht immer die richtige.
Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr Aberglaube entdecke ich in der Welt. Ein Hexenschuss heißt so, weil man sich den plötzlichen Schmerz nicht anders erklären konnte, als dass der Leidende von dem unsichtbaren Pfeil einer Hexe getroffen worden sein musste. Hufeisen, Kleeblätter, Schweine aus Marzipan, Wachsgießen. Silvester bringt den Aberglauben so richtig zum Vorschein. Alles harmlose Bräuche ohne Bedeutung?
An Silvester stehen wir zu viert in meiner Küche und blicken uns fest in die Augen, als wir mit dem ersten Sekt des Abends anstoßen. Ansonsten drohen sieben Jahre schlechter Sex. Dass ich danach belächelt werde, weil mich das verschüttete Salz beunruhigt: unverständlich.
Eine Freundin fragt mich, ob ich schwanger sei, weil sie letzte Nacht genau das geträumt habe. Und als ich eine andere Freundin frage, welchen Aberglauben sie mit sich herumträgt, schreibt sie: „Ich muss immer auf Holz klopfen, wenn ich was Gutes sage. Zum Beispiel: Ich hatte noch kein Corona.“ Und wenige Sekunden später: „Ich hab’s sogar jetzt gemacht, als ich es schrieb.“
Freunde erzählen mir, dass sie an Karma glauben oder nicht im Haus pfeifen, weil man sich so das Unglück herbeiruft. Sie sagen, dass man Schuhe keinesfalls auf den Tisch stellen darf, weil das ebenfalls Unglück bringt. Krümel mit der bloßen Hand statt mit einem Lappen aufzuwischen, macht arm. Manchmal denke ich daran, wenn ich über den Esstisch wische, und nehme trotzdem die Hand. Bisher hat mich das nicht arm gemacht. Klopf, klopf, klopf.
Die meisten, die ich frage, sagen dazu: „Kann ja nicht schaden.“ Deswegen wünscht sich auch mein Freund etwas, wenn ich ihm eine Wimper von der Wange frickele, obwohl er sonst über mich lacht. Deswegen lehnt man das Wunscherfüllungsangebot einer Sternschnuppe nicht ab. Deswegen pusten wir Kerzen auf dem Kuchen aus und wünschen uns etwas ganz fest. Und weil das alles ein klitzekleines bisschen mehr ist als bloß Brauchtum, verrät niemand, was er sich gewünscht hat. Nachher geht der Wunsch nicht in Erfüllung.
Der größte Feind meines Aberglaubens ist mein Freund. Ein rationaler Mann, der sich weder von Zeichen noch von vermeintlichen Zusammenhängen überzeugen lässt. Dass er und meine Oma sich den Geburtstag teilen, findet er höchstens lustig. Ich hingegen fühle mich in meinen Gefühlen bestätigt: beides sehr gute Menschen. Manchmal versucht er mich zu überzeugen, dass es keine Argumente für meinen Aberglauben gibt. Vergebens: Weiß ich ja. Trotz Unglaubens macht er mit: Wimper, Kerzen, in die Augen gucken. „Schönes Ritual“, sagt er. Und: „Meine Abiturprüfungen wären doch kein Stück anders gelaufen, hätte meine Mutter mir keinen Schoko-Marienkäfer auf den Frühstückstisch gelegt.“ Ich stimme zu und denke still: Wer weiß.
Warum bin ich so anfällig und er kein bisschen? Auch hierfür gibt es eine neurologische Erklärung. Die Gehirne der Menschen, die an Übersinnliches glauben, haben einen fast schon übertriebenen Hang zur Assoziation. Sie sehen mehr in den Tintenklecksen des Rorschachtests und verknüpfen öfter und schneller Worte miteinander, die eigentlich nicht zusammengehören.
Obwohl ich mich meist belächelt fühle, bin ich nicht allein mit meinem musterspinnenden Gehirn. Der Anteil abergläubischer Menschen hat sich seit den Siebzigern mehr als verdoppelt, fand eine Allensbach-Umfrage 2005 heraus. Je weiter die Welt wird, desto mehr sehnt sich der Mensch nach einfachen Antworten, so scheint es. Aberglaube gibt nicht nur Sicherheit, er befreit auch von der Last der Verantwortung. Glück und Pech haben nichts mit der eigenen Leistung zu tun, sondern mit höheren Mächten. Deswegen ist es kurios, aber nicht überraschend, dass in den Tierheimen schwarze Tiere am schwersten vermittelt werden können. Für 2021 haben die Berliner Schornsteinfeger einen Kalender herausgebracht, auf dem sie mit schwarzen Katzen, Kaninchen und Hunden aus dem Tierheim posieren. Man hofft, dass etwas Glück auf die vermeintlich pechbringenden Tiere abfärbt.
Der Arbeitsminister Hubertus Heil schlug 2019 vor, das 13. Sozialgesetzbuch zu überspringen und direkt zum 14. überzugehen, schließlich sei die 13 für viele Menschen eine Unglückszahl. Das gehe so nicht, spotteten viele. Das sei irrational und Rücksichtnahme auf eine winzige Gruppe. In jüngsten Umfragen gaben 82 Prozent an, die 13 für eine Unglückszahl zu halten. Das neue Sozialgesetzbuch soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Es ist das 14., ein 13. ist nicht in Planung.
Aberglaube beunruhigt vor allem dann, wenn man ihn an vermeintlich rationalen Orten entdeckt. Zum Beispiel im Arbeitsministerium, im Flugzeug oder im OP-Saal. Eine nervöse Pilotin, die eine schwarze Katze gesehen hat, ein unsicherer Chirurg, der gedankenverloren die Tür zur Herz-OP mit dem falschen, dem anderen Arm als sonst aufgestoßen hat.
Obwohl bewiesen ist, dass schwarze Katzen kein Unglück bringen und die Hand, mit der man eine Tür öffnet, keinen Einfluss auf den Verlauf von OPs hat, versetzt der Glaube daran fast Berge. 2010 belegten Psychologen der Universität Köln, dass der Glaube an einen Glücksbringer oder ein Ritual tatsächlich zu besseren Leistungen führt. Die Forscher baten Studierende, einen Golfball einzulochen. Die eine Gruppe sollte einfach nur genau treffen, der anderen Gruppe sagten die Forscherinnen, sie spielten mit Glücksbällen. Der Glaube daran ließ die Glücksgolfer tatsächlich besser spielen.
Es ist kein Zufall, dass ich mich gerade jetzt mit meinem eigenen und dem Aberglauben der Welt beschäftige. In Krisen werden Menschen abergläubischer. Eigentlich müssten mich viele gerade besser verstehen. Doch diese Krise ist auch zum Kampf von Wissen gegen Glauben geworden. Ratio gegen Intuition. Wissenschaftliche Fakten scheinen verhandelbar geworden zu sein, etwas, das man eben glaubt oder nicht.
Die Angst ist schlimmer als die Krankheit, schrien die Querdenker, die den Regierungen Panikmache vorwarfen. Angst esse Seelen auf. Es ist die Idee, dass die eigenen Gedanken mächtiger sein könnten als Fakten. Dass die Angst vor einer Krankheit die Krankheit selbst erst erschafft. Dass die, die auf den Intensivstationen liegen, nur zu sehr an das Virus geglaubt haben. Dass eine Erkrankung eine Entscheidung ist. Es ist der bösartigste Versuch, die Pandemie zu verklären.
Es ist eine Idee, der sich auch der Aberglaube bedient und das magische Denken der Kinder. Gedanken können mächtig sein. Das weiß auch die Naturwissenschaft: Die Erkenntnisse über Placebo und Nocebo zeigen, dass der Geist über den Körper bestimmen, Symptome lindern oder auslösen kann. Wirkung ohne Ursache – außer dem Glauben. Ich beginne, mit meinem Aberglauben, meinem irrationalen Verhalten zu hadern. Wenn mein Kopf das kann, frage ich mich, was kann er dann noch?
Ich erzähle meinem Freund davon. Er sagt: „Dann lass es.“ Lass die Quersummenwecker und das Klopfen auf Holz. Ich winde mich. Oft genug stehe ich zu Uhrzeiten auf, deren Quersumme ich nicht kenne. Wenn Wochenende ist, wenn ich verschlafe, wenn ich vor dem Wecker wach werde. Diese Tage sind nicht schlechter als andere. Ich weiß das. Aber an Tagen, an denen ich nicht nur Können, sondern Glück brauche, rechne ich im Kopf die Zahlen zusammen und stelle den Wecker, sodass eine Sieben herauskommt. Ich werde das nicht ändern können.
Mein Freund grinst, als ich das zugebe. Wir beide wussten schon vorher, dass ich es nicht einfach lassen kann. Dass ich es nicht will. Es sind kleine Rituale, die auszuführen mich weniger Denkleistung kostet, als es zu lassen. Ich glaube, dass sie mir nicht schaden. Ich glaube an Dinge, deren Verantwortung mir obliegt. Wann ich aufstehe, ob ich auf Holz klopfe oder was ich mir wünsche, wenn ich eine Wimper wegpuste.
Manches davon hat noch nie funktioniert. Nicht ein einziges Mal. Ich glaube trotzdem daran. Mein Leben könnte nur aus Ratio bestehen, aus Wissenschaft und Wahrscheinlichkeit, aber ich will das gar nicht. Ich bin froh, dass ich die Irrationalität auch in anderen entdecke. Erleichtert, dass meine Freunde auch komische Rituale durchführen, dass sie manchmal glauben, statt zu wissen. Künstliche Intelligenz kann Ratio lernen, aber sie scheitert am Irrationalen: an Intuition, Schicksal, Glück und Pech. An Dingen, die uns menschlich machen. Leben lässt sich nicht nur mit Statistik erklären, nicht ausschließlich mit Naturwissenschaft. Auch nicht in einer Pandemie. Aberglaube ist auch Hoffnung. Hoffnung, dass es gut geht, dieses Leben.
Gern hätte ich den Pragmatikern und Rationalistinnen am Ende gesagt, dass die Fakten mich überzeugt haben, nicht mehr zu glauben. Aber Glaube, das macht ihn aus, ist resistent gegen Fakten. Ich glaube an mein Glück. Klopf, klopf, klopf.